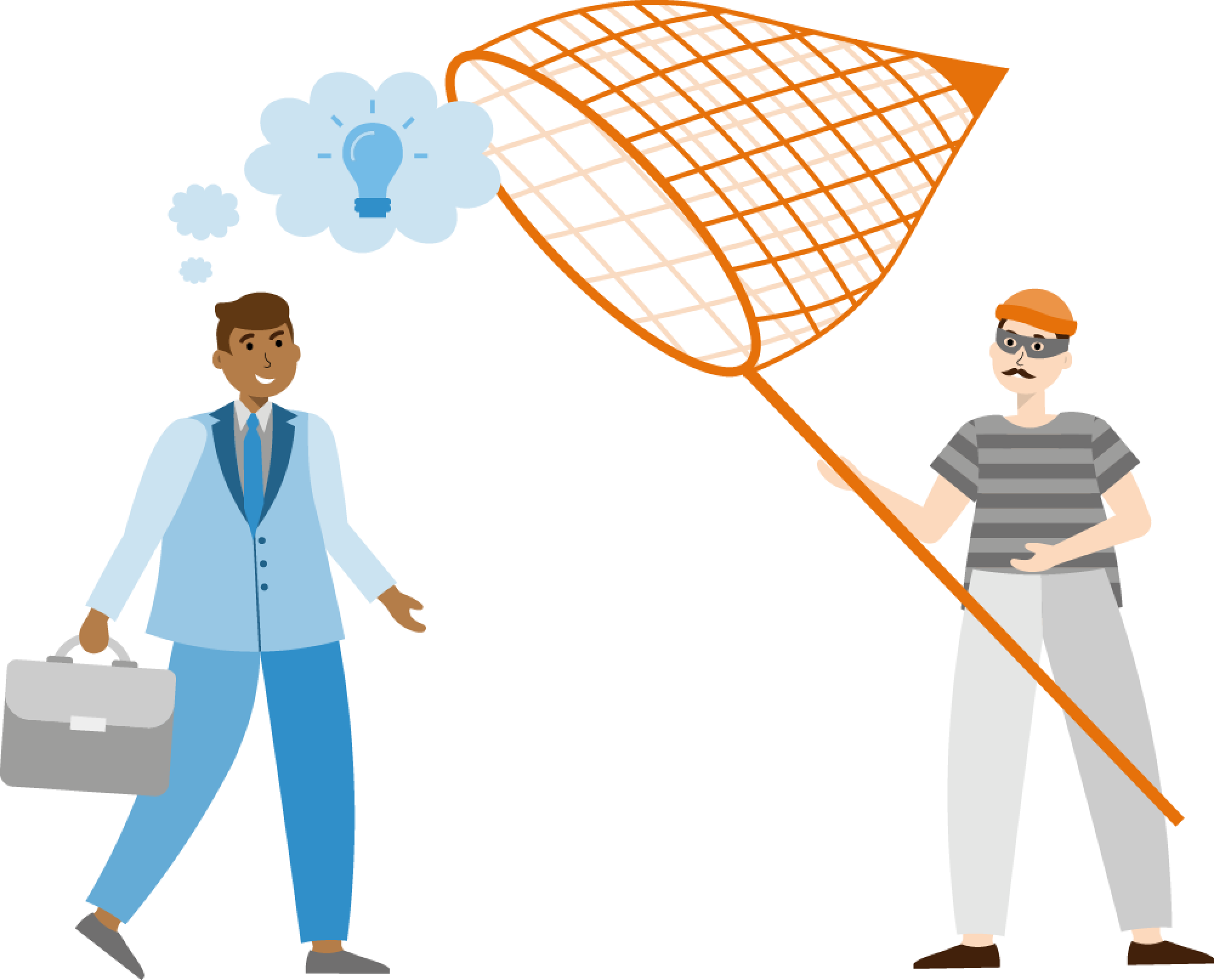Wen schützt das Urheberrecht?
Wen schützt das Urheberrecht?
Das sogenannte "Urheberrecht" wird in Deutschland im "Urheberrechtsgesetz" geregelt. Dabei kommen verschiedene Rechte zur Anwendung:
- das Urheberpersönlichkeitsrecht (UrhG, Abschnitt 4, Unterabschnitt 2 (§§ 12-14)): beschreibt die Anerkennung der Urheberschaft einer Person an seinem Werk. Das Urheberrecht entsteht automatisch mit der Schaffung eines Werkes. Eine Registrierung ist nicht erforderlich.
- Verwertungsrechte (UrhG, Abschnitt 4, Unterabschnitt 3 (§§ 15- 23)): regelt das Recht auf Vervielfältigung, Verbreitung, Ausstellung und öffentliche Zugänglichmachung. Dadurch soll sichergestellt werden, dass der Urheber aus seinem geschaffenen Werk auch einen wirtschaftlichen Nutzen ziehen kann. Durch das Verwertungsrecht hat der Urheber z.B. das Recht gegen jemanden vorzugehen, der das Werk falsch/in nicht erlaubter Weise nutzt.
- Nutzungsrechte (UrhG, Abschnitt 5, Unterabschnitt 2, §§ 31 – 44): räumt anderen das Recht ein, das Werk zu nutzen. Nutzungsrechte beziehen sich immer auf konkrete Nutzungsarten. Wer aber beispielsweise die Rechte erwirbt ein Text zu vervielfältigen und zu verbreiten, ist nicht befugt z.B. daran Änderungen vorzunehmen.
Zweck des Urheberrechts
Das Urheberrecht dient dem Schutz der Urheber:innen, also derjenigen, die ein Werk geschaffen haben. Wer z.B. ein Buch oder einen Artikel geschrieben hat, soll davor geschützt werden, dass andere sich dieses Werk aneignen und es für ihren eigenen Vorteil nutzen, ohne vorher um Erlaubnis zu bitten oder eine angemessene Vergütung zu zahlen.
Wer ist Urheber:in?
Ein:e Urheber:in ist immer eine natürliche Person. Juristische Personen wie Hochschulen oder Stiftungen können keine Urheber:innen sein. In einem akademischen Kontext haben Studierende, Doktorand:innen und Habilitand:innen das Recht, als Urheber:innen ihrer eigenen Werke anerkannt zu werden und die Nutzungsrechte an diesen Werken zu besitzen.
Schutzdauer
Der Schutz eines Werkes durch das Urheberrecht gilt für 70 Jahre nach dem Tod der Urheber:innen. Bei mehreren Urheber:innen wird dieser Zeitraum nach dem Tod des am längsten lebenden Miturhebers berechnet. Bei Sammelwerken beginnt die Schutzfrist erst 70 Jahre nach dem Ableben aller beteiligten Autor:innen und Herausgeber:innen.
Was schützt das Urheberrecht?
Das Urheberrecht schützt das geistige Eigentum, also Ihre einzigartigen Werke, seien es Texte, Bilder, Musik oder Filme. Es gilt für jede natürliche Person, die durch eigene schöpferische Leistung ein Werk geschaffen hat.
Was ist urheberrechtlich geschützt?
Das Urheberrecht schützt spezifische Ausdrucksformen von Ideen. Dazu gehören:
-
Sprachwerke (Texte)
-
Musikwerke
-
Werke der bildenden Kunst
-
Lichtbildwerke (Fotografien)
-
Filmwerke
-
Wissenschaftliche Darstellungen
-
Übersetzungen und Bearbeitungen
-
Sammelwerke und Datenbanken
Das Urheberrecht schützt also die konkrete Ausgestaltung von Ideen und Ausdrucksformen. Nicht geschützt sind allgemeine Informationen, Tatsachen oder wissenschaftliche Erkenntnisse, sofern sie nicht in einer schöpferischen Form vorliegen.
Schöpfungshöhe
Um urheberrechtlichen Schutz zu genießen, muss ein gewisses Maß an Individualität und Originalität erreicht werden - die sogenannte "Schöpfungshöhe". Dabei kommt es nicht allein auf Fleiß oder handwerkliches Geschick an, sondern auf die schöpferische Gestaltung des Werkes. Forschungsdaten wie Anamnesen oder Fragebögen sind daher nicht immer urheberrechtlich geschützt!
Weisungsgebundene und weisungsfreie Tätigkeiten
In der akademischen Welt gibt es unterschiedliche Regelungen zur Urheberschaft:
- Weisungsgebundene Tätigkeiten: Wissenschaftliche Mitarbeiter:innen oder studentische Hilfskräfte, die unter Anleitung eines Hochschullehrers arbeiten, sind in der Regel weisungsgebunden. Sie besitzen zwar das Urheberrecht an ihren Werken, die Nutzungsrechte werden aber häufig dem Arbeitgeber bzw. der Hochschule eingeräumt. Das bedeutet, dass die Hochschule das Recht hat, die Arbeiten zu nutzen und zu verwerten.
- Weisungsfreie Tätigkeiten: Studierende oder Doktorand:innen, die unabhängig arbeiten und kreative Leistungen erbringen - wie bei Abschlussarbeiten oder Dissertationen - behalten in der Regel alle Nutzungsrechte an ihren Arbeiten.