Darf ich Instagram-Beiträge in OER nutzen? – Fall des Monats August ’25
Das Team der Rechtsinformationsstelle ORCA.nrw unterstützt Lehrende aus Nordrhein-Westfalen bei rechtlichen Fragen. Im Format „Fall des Monats“ stellt es regelmäßig einen besonderen Sachverhalt vor, der sich aus einer zu bearbeitenden Anfrage oder aus aktueller Rechtsprechung ergibt.
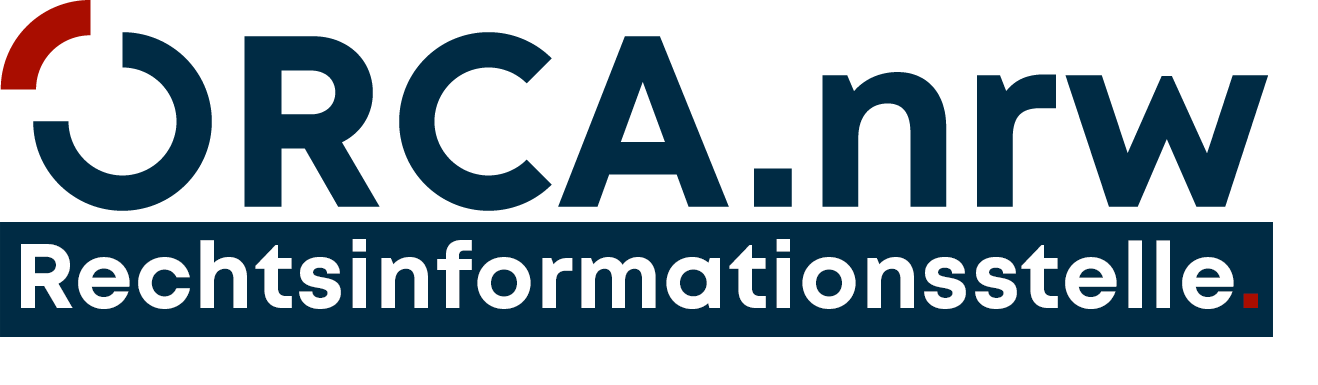
Ausgangspunkt
Im Rahmen einer Vorlesung möchte eine Dozentin Inhalte aus TikTok und Instagram einbinden, um Studierenden anhand authentischer Beispiele Kommunikationsstile, Medieneffekte oder gesellschaftliche Narrative zu veranschaulichen. Die Videos sollen dann von den Studierenden analysiert und kommentiert werden. Später möchte die Lehrende die Materialien als OER veröffentlichen. Sie fragt sich, ob dies überhaupt urheberrechtlich erlaubt ist. Zudem möchte sie wissen, ob dafür die Inhalte in den Lehrmaterialien eingebettet oder auch heruntergeladen werden dürfen.
Rechtliche Bewertung
Social Media ist kein rechtsfreier Raum. Auch öffentlich zugängliche Posts, Bilder oder Videos sind urheberrechtlich geschützt, z.B. als Lichtbildwerke (§ 2 Abs. 1 Nr. 5 UrhG), Lichtbilder (§ 72 UrhG) oder Filmwerke (§ 2 Abs. 1 Nr. 6 UrhG). Die bloße Zugänglichkeit im Netz bedeutet nicht, dass Inhalte frei genutzt oder übernommen werden dürfen. Für die Verwendung von Social-Media-Beiträgen zur Erstellung von OER hängt die urheberrechtliche Bewertung maßgeblich von der konkret geplanten Nutzung ab. Nutzungsformen mit einer Vervielfältigung (§ 16 I UrhG) oder Veränderung der Inhalte (§ 23 I 1 UrhG), z.B. durch Speicherung auf einem anderen Server oder Erstellen von Screenshots, unterliegen den Regelungen des Urheberrechts und bedürfen daher einer Nutzungserlaubnis. Das bloße Verlinken auf einen Inhalt ist hingegen urheberrechtlich unbedenklich.
Eine Nutzungserlaubnis, die eine Verwendung der Inhalte genehmigt, kann sich aus den Nutzungsbedingungen der einschlägigen Plattform, aus einem Lizenzvertrag oder durch die gesetzlich geregelten Schranken der §§ 44a ff. UrhG ergeben.
1. Lizenzverträge und Nutzungsbedingungen von TikTok, Instagram und Co.
Jede Social-Media-Plattform unterliegt eigenen Nutzungsbedingungen, in denen regelmäßig auch urheberrechtlich relevante Bestimmungen enthalten sind. Das Urheberrecht an hochgeladenen Inhalten verbleibt bei dem jeweiligen Content Creator. Zugleich wird durch das Hochladen regelmäßig eine einfache, weltweite, nicht-exklusive Lizenz zugunsten des Plattformbetreibers eingeräumt, die diese bestimmten Nutzungen innerhalb der Plattform erlaubt (z.B. Instagram unter 4.3 https://help.instagram.com/581066165581870/?locale=de_DE, Stand 12.08.2025). Teilweise sehen die Nutzungsbedingungen auch vor, dass anderen Nutzern der Plattform eine eingeschränkte Lizenz zur Nutzung der Inhalte eingeräumt wird (siehe Nutzungsbedingungen von TikTok unter 4.9 https://www.tiktok.com/legal/page/eea/terms-of-service/de, Stand 12.08.2025). Diese Nutzungsrechte sind jedoch in der Regel auf private bzw. unterhaltende Zwecke beschränkt und erfassen weder wissenschaftliche noch didaktische Nutzungen. Spezielle Regelungen für den Einsatz im Rahmen von Forschung und Lehre enthalten die gängigen Plattformbedingungen, wie von TikTok und Instagram, nicht. Lehrende erhalten also regelmäßig kein eigenständiges vertragliches Nutzungsrecht, das über die reine plattforminterne Wiedergabe hinausgeht.
Unabhängig von diesen vertraglichen Bestimmungen kann eine rechtmäßige Nutzung jedoch auch auf einer explizit erteilten Lizenz beruhen (§ 31 UrhG), z.B. indem der Content Creator in seiner Profilbeschreibung ausdrücklich teilt, dass seine gesamten Inhalte frei genutzt werden dürfen. Dies gilt dann ebenso für einzelne Inhalte, die Content Creator unter einer freien Lizenz, wie Creative Commons (https://de.creativecommons.net/was-ist-cc/, Stand 12.08.2025), veröffentlicht haben. Es ist zu beachten, dass bei der Verwendung von CC-lizenzierten Inhalten in OER die jeweilige Lizenz eingehalten werden muss. Wird OER-Material mit mehreren Werken kombiniert, die unterschiedlichen CC-Lizenzen unterliegen, ist in der Regel die restriktivste Lizenz für die Weiterverbreitung maßgeblich. Die Einhaltung der Lizenzbedingungen ist für eine rechtmäßige Nutzung zwingend erforderlich.
2. Gesetzliche Schranken
Der zentrale Erlaubnistatbestand für eine rechtmäßige Nutzung von fremden Inhalten ist das Zitatrecht gemäß § 51 UrhG. Das Zitatrecht erlaubt die Vervielfältigung, Verbreitung und öffentliche Wiedergabe veröffentlichter Werke, sofern ein besonderer Zitatzweck vorliegt. Dieser setzt voraus, dass sich der Nutzer, also die Person, die den Inhalt einbindet, geistig mit dem Werk auseinandersetzt, beispielsweise durch Kritik, Analyse oder Kommentierung. Eine bloße Wiedergabe ohne eigene inhaltliche Auseinandersetzung genügt nicht. Demnach ist die Nutzung zu dekorativen oder ausschmückenden Zwecken nicht zulässig. Ob z.B. die Nutzung von Screenshots zur Darstellung eines zu vermittelnden Inhalts in einer Aufgabenstellung eine solche Auseinandersetzung ist, ist nicht pauschal zu beantworten. Bei Aufgabenstellungen erfolgt die geistige Auseinandersetzung regelmäßig nicht durch den Nutzer, sondern der Nutzer erwartet eine geistige Auseinandersetzung durch einen Dritten. Eine Berufung auf das Zitatrecht ist dann bei klassischen Aufgabenstellungen, die den Studenten zur Erörterung anregen soll, nicht möglich. Einzelfälle können hiervon abweichen.
Zusätzlich könnte im Rahmen von Social Media auch die Schranke für Karikaturen, Parodien und Pastiche gem. § 51a UrhG relevant werden. Danach darf ein Werk abgebildet oder auf sonstige Weise vervielfältigt werden, wenn dies zum Zwecke der Karikatur, der Parodie oder des Pastiches getan wird. Die drei Kunstformen setzen voraus, dass das Original zwar erkennbar bleibt, aber in veränderter Weise genutzt wird, sei es zur satirischen Überzeichnung, humorvollen Verfremdung oder stilistischen Nachahmung. Bei der Anwendung der Schranke des § 51a UrhG ist jedoch Vorsicht geboten. Der Begriff des Pastiches stammt aus dem Unionsrecht und wurde erst vor einigen Jahren ins deutsche Recht umgesetzt, weshalb dieser noch weitgehend ungeklärt ist. Zurzeit werden richtungsweisende Urteile des EuGH erwartet, die mehr Rechtssicherheit schaffen sollen.
3. Anmerkungen
Eine Nutzung von Social-Media-Inhalten kann alternativ auch durch die gesetzlichen Schranken der §§ 60a, 60c UrhG gedeckt sein, erlaubt jedoch nicht deren Weitergabe als OER. So gestattet § 60a UrhG die Verwendung von Inhalten zur Veranschaulichung von Unterricht und Lehre in nicht-kommerziellen Lehrveranstaltungen mit begrenztem Teilnehmerkreis, etwa durch die vollständige Übernahme kürzerer Videos. Für Zwecke wissenschaftlicher Forschung eröffnet § 60c UrhG ebenfalls Nutzungsmöglichkeiten, solange diese nicht kommerziell erfolgen und dem Forschungszweck dienen. In beiden Fällen bleibt jedoch eine Veröffentlichung außerhalb des geschützten Kontexts ausgeschlossen.
Sollte eine Nutzung durch eine gesetzliche Schranke erlaubt sein, so muss bei der Nutzung grundsätzlich die Quelle angegeben werden (§ 63 Abs. 2 UrhG). Beim Layout von Instagram oder TikTok gehört der Accountname zur üblichen Darstellung, die Quellenangabe sollte also in jedem Fall den Urheber und den Ursprungsort beinhalten.
Fazit
Die Nutzung von Social-Media-Inhalten in Lehrmaterialien ist rechtlich komplex. Zwar räumen Social-Media-Plattformen den Usern durch die Nutzungsbedingungen keine Erlaubnis für Nutzungen in OER ein, jedoch können trotzdem gesetzliche Schranken wie das Zitatrecht die Nutzung unter bestimmten Bedingungen ermöglichen. Auch CC-Lizenzen bieten rechtssichere Alternativen, wenn sie korrekt angewendet werden, was jedoch selten der Fall sein wird. Entscheidend bleibt in jedem Fall die vollständige und transparente Quellenangabe, um urheberrechtliche Konflikte zu vermeiden und die Rechte des Urhebers zu wahren.
 © Canva
© Canva © ORCA.nrw
© ORCA.nrw © Canva
© Canva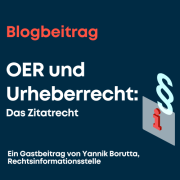

 © Canva
© Canva
 © Canva
© Canva © Canva
© Canva
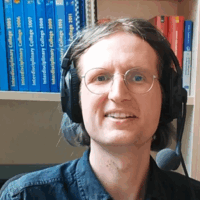
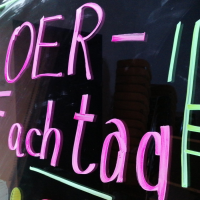 © Scherer, HHU
© Scherer, HHU