Ist eine Überprüfung und Speicherung studentischer Arbeiten mittels Plagiatssoftware zulässig? – Fall des Monats September ’25
Das Team der Rechtsinformationsstelle ORCA.nrw unterstützt Lehrende aus Nordrhein-Westfalen bei rechtlichen Fragen. Im Format „Fall des Monats“ stellt es regelmäßig einen besonderen Sachverhalt vor, der sich aus einer zu bearbeitenden Anfrage oder aus aktueller Rechtsprechung ergibt.
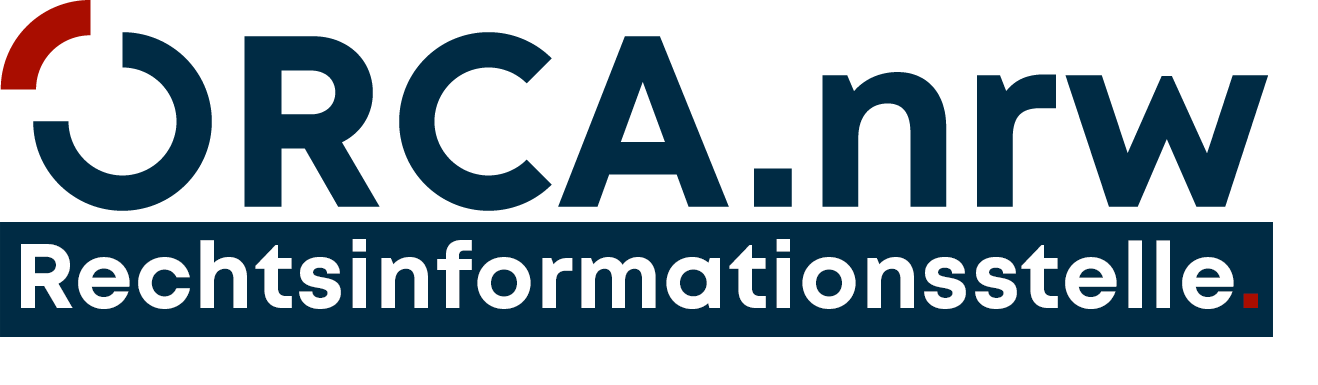
Ausgangspunkt
Bei einer Lehrveranstaltung sollen Hausarbeiten durch die Studierenden als Prüfungsleistung erstellt werden. Die Hausarbeiten sind als ausformulierter Text mit erheblichem Gestaltungsspielraum zu erstellen. Im Rahmen der Korrektur dieser Hausarbeiten sollen diese durch einen externen Dienstleister mit Hilfe einer Software auf Plagiate geprüft werden. Der externe Dienstleister wird die Arbeiten zudem über die konkrete Überprüfung hinaus abspeichern, um spätere Abgaben oder Abgaben aus anderen Prüfungen damit zu vergleichen. Eine Löschung erfolgt nicht. Hierbei stellen sich mehrere rechtliche Fragen aus urheberrechtlicher Sicht: Sind studentische Prüfungsarbeiten überhaupt urheberrechtlich geschützt? Hat die Hochschule ein Nutzungsrecht an den Arbeiten oder kann sie fordern das solche eingeräumt werden? Dürfen studentische Prüfungsarbeiten auch ohne Nutzungsrecht auf Plagiate überprüft werden? Macht es einen Unterschied, ob die Arbeiten darüber hinaus gespeichert werden oder nicht?
Rechtliche Bewertung
Studentische Arbeiten sind urheberrechtlich geschützt, sofern sie eine persönliche geistige Schöpfung (§ 2 Abs. 2 UrhG) auf den Gebieten der Literatur, Wissenschaft oder Kunst darstellen, also ein Werk sind (§ 1 UrhG). Hierbei muss diese Schöpfung zwar noch ein Mindestmaß an kreativer Leistung enthalten (Schöpfungshöhe), die Ansprüche daran sind allerdings regelmäßig gering (sog. kleine Münze). Sofern studentische Arbeiten diese Voraussetzungen erfüllen, kommt ihnen urheberrechtlicher Schutz zu, was in der Regel der Fall ist. Das gilt auch für Arbeiten, die als Prüfungsleistung erstellt werden. Urheber und damit Rechtsinhaber ist immer der Schöpfer (§ 7 UrhG) und damit der Studierende. Geschützt ist bei wissenschaftlichen Arbeiten aber nur die Form und nicht der Inhalt, daher muss für die Beurteilung der Schutzfähigkeit auf die schöpferische Eigenart der Form abgestellt werden. Dies ist bei Texten die Art der Formulierung und nicht der Inhalt des Textes. Sofern keine eigene Formulierung möglich ist – wie beispielsweise bei rein mathematischen Beweisen ohne möglichen Gestaltungsspielraum – kann ein urheberrechtlicher Schutz ausnahmsweise ausgeschlossen sein.
Hochschulen kommt per se kein Recht an den Arbeiten der Studierenden zu. Sie sind insbesondere keine Arbeitnehmer, sodass die Regelungen des Arbeitnehmerurheberrechts (§§ 43, 69b UrhG) nicht anwendbar sind. Fraglich ist aber, ob die Hochschule Nutzungsrechte von den Studierenden einfordern können. Grundsätzlich sind auch öffentlich-rechtlich begründete Nutzungsrechtseinräumungen möglich (ein gesetzliches Beispiel ist § 16 DNBG), sodass auch über eine Prüfungsordnung eine Nutzungsrechteinräumung geregelt werden kann. Diese Regelungen müssen allerdings für sich verhältnismäßig sein, sodass auch den Zweck der Nutzungsrechtseinräumung abzustellen ist. Hierbei ist zwischen dem Recht der Hochschule auf wissenschaftliche Redlichkeit – die auch im Rahmen einer Prüfung überprüft wird – und den persönlichkeits- wie eigentumsrechtlichen Positionen des Studierenden abzuwägen.
Bei einem reinen Vergleich der Prüfungsarbeit durch eine Software wird diese Verhältnismäßigkeit gegeben sein. Anders wird dies aber zu beurteilen sein, wenn die Arbeit auch für spätere Vergleiche abgespeichert werden soll. Hier wird die Verhältnismäßigkeit regelmäßig scheitern. Insbesondere wiederholende Prüfungsaufgaben sind kein Grund für eine solche Abspeicherung. Erst recht gilt das, wenn die Arbeit bei Dritten – möglicherweise gewerblich tätigen – Anbieter erfolgen soll, da ein – durch die Nutzungsrechtseinräumung – begründeter Eingriff in die urheberrechtliche Position des Studierenden zugunsten eines möglicherweise wirtschaftlichen Vorteils eines Dritten nicht mehr gedeckt ist. Sofern kein Nutzungsrecht der Hochschule besteht, kann möglicherweise dennoch eine Prüfung auf Plagiate erfolgen. Hierfür müsste die Plagiatsprüfung durch eine urheberrechtliche Schranke möglich sein. Insbesondere die Schranke des § 45 Abs. 1 UrhG wird hier eine solche Kontrolle gestatten, da die Bewertung und Kontrolle der Prüfungsleistung selbst Teil eines Verwaltungsverfahrens ist und die Schranke auch vorbereitende Handlungen in einem solchen Verfahren abdeckt. Hinsichtlich der Reichweite der Nutzung wird – wie schon bei der Einräumung des Nutzungsrechts – nur der reine Vergleich, nicht aber die weitere Abspeicherung gestattet sein. Letztere Handlung wird aufgrund der grundsätzlichen engen Auslegung von urheberrechtlichen Schranken nicht mehr von § 45 Abs. 1 UrhG gedeckt sein. Sofern die Kontrolle bei einem externen Anbieter stattfindet, kommt eine direkte Anwendung des § 45 Abs. 1 UrhG nicht in Betracht, da eine Weitergabe von der Schranke nicht umfasst ist. Allerdings kann der reine Vergleich auf externen Systemen als technisch bedingte Vervielfältigung i.S.d. § 44a Nr. 2 UrhG gesehen werden und damit für sich zulässt sein. Eine darüberhinausgehende zeitliche Abspeicherung kommt aber auch hier nicht in Frage.
Fazit
Grundsätzlich können die urheberrechtlich geschützten Arbeiten von Studierenden der Plagiatsprüfung unterzogen werden, unabhängig davon, ob ein Nutzungsrecht eingeräumt wurde oder nicht. Die Schrankenregelungen der §§ 45 Abs. 1, 44a Nr. 2 UrhG erlauben grundsätzlich die reine Plagiatsprüfung bei studentischen Prüfungsarbeiten. Die Abspeicherung der Arbeiten für spätere Plagiatskontrollen ist aber durch diese Vorschriften nicht mehr gedeckt. Dabei macht es keinen Unterschied, ob die Arbeit durch einen Dritten oder die Hochschule selbst geprüft werden. Zudem sind entsprechende Klauseln in Prüfungsordnungen – die ein Nutzungsrecht für eine solche weite Abspeicherung gestatten sollen – unverhältnismäßig. Daher können studentische Prüfungsarbeiten für spätere Plagiatsprüfungen nicht mehr herangezogen werden. Insoweit sollte immer geprüft werden, ob die verwendete Software zur Plagiatskontrolle die Arbeiten über die konkrete Kontrolle hinaus abspeichern.
Weitergehende Literatur
Konertz, Roman, Urheberrechtliche Fragen der Plagiatskontrolle an Hochschulen – Über automatisierten Abgleich und Abspeicherung von Prüfungsarbeiten ZUM 2024, 355-364

