Open Science und Open Education: Auch ohne Open Source?
Gastbeitrag von Steffen Rörtgen (links im Bild) und Christian Friedrich
Am 17. Juni waren wir eingeladen, um einen Workshop im Rahmen der KNOER Tagung zu geben. Das Thema: Offene Software als Basis für die Öffnung von Lehre und Forschung. Mit den Teilnehmenden haben wir an der Frage gearbeitet, ob und wie Open-Source-Software (OSS) eine Voraussetzung für die Praxis in freier Bildung und Wissenschaft ist.
Wir haben uns der Frage aus drei Perspektiven genähert:
- Die Perspektive eines Ethos von Open Science und Open Education, der besagt, dass alle die Möglichkeit zur Teilhabe an Wissenschaft und Bildung haben sollen.
- Die Perspektive der Hochschule und ihrer Strategiefähigkeit. Strategiefähigkeit ist aus unserer Sicht u.a. die Praxis einer Hochschule, sich Handlungsoptionen und Entscheidungsmöglichkeiten in einem absehbaren Zeitraum zu erhalten und auszubauen, in einer selbstbestimmten Art und Weise auf wechselnde Bedingungen im Umfeld sowie im Inneren der Organisation zu reagieren und diese selbstbestimmt zu formen. Vielleicht keine Schulbuch-Definition, aber für unseren Workshop hat diese Kurzdefinition getragen. Dass wir hier und im fortlaufenden Beitrag über Hochschulen schreiben, ist auch dem Umstand geschuldet, dass die Teilnehmenden überwiegend aus der Hochschulbildung und angrenzenden Bereichen kamen.
- Die Perspektive der realen Umstände, unter denen Hochschulen bereits jetzt Open Education und Open Science sowohl mit OSS als auch mit proprietären Produkten realisieren.
Dem TRIZ-Modell der Liberating Structures folgend haben wir zunächst an möglichst kontra-intuitiven Fragen gearbeitet. Die Teilnehmenden hatten die Aufgabe, Motivationen, Praktiken und Strukturen zu identifizieren, die der Entstehung einer resilienten, selbstbestimmten Hochschule, die Freiheit in der Didaktik und der wissenschaftlichen Praxis ermöglicht und für die Glaubwürdigkeit von Lehre und Forschung eintritt, entgegenstehen.
Im zweiten Teil des Workshops war die Aufgabe, Lösungen und Vorschläge zu erarbeiten, die Hochschulen, Länder und Bund angehen können, um den dystopischen Szenarien aus dem vorhergehenden Arbeitsschritt zu entkommen. In einer anschließenden Zusammenführung haben wir in Gruppen Forderungen abgeleitet.
Die Forderungen aus den Arbeitsgruppen haben wir zusammengetragen und diskutiert:
- Openness als Kriterium für Fördermittel
- Nachhaltige Archivierung und öffentliche Verfügbarmachung der Ergebnisse [von Forschungsprozessen]
- Nachnutzung vorhandener Infrastruktur
- Bereitstellung öffentlicher Infrastruktur
- Kompetenzzentren (föderal / bundesweit?) oder übergreifende Verankerung [von Kompetenzclustern]
- Stärkung der Open Data Literacy
- Verbindliche Nutzung von Standards
- Standardisierte Schnittstellen
- Verlässliche Finanzierungsrahmen für Open-Source-Entwicklung
- Rechtssicherheit für offenes Handeln (Teilen, Weiterentwicklung von Open-Source-Software)
Dieser Blog Post wird den Austausch und die inhaltliche Diskussion des Workshops nicht komplett wiedergeben können. Wir möchten aber einen Blick auf einzelne der Forderungen legen, weil sie uns besonders wichtig erscheinen.
Rechtssicherheit für offenes Handeln
Kaum eine Veranstaltung im Kontext von Open, bei der nicht jemand aus eigener Erfahrung davon berichtet, man habe seinen eigenen Content, Code oder erhobenes Datenmaterial nicht offen teilen können, weil es in der Verwaltung oder Leitung einer öffentlichen Einrichtung Vorbehalte gegeben habe. Argumente klingen dann in etwa so, dass haushaltsrechtliche Bestimmungen einer Veröffentlichung im Wege stünden. Es könne ja nicht sein, dass Einrichtung X aus ihrem Haushalt eine Leistung erbringe, die dann Einrichtung Y gratis zur Verfügung stünde. In vielen wissenschaftlichen Disziplinen sind diese Vorbehalte inzwischen abgeräumt, aber sowohl in der Forschung als auch in der Verwaltung und der Lehre ist dieses Problem unter Praktiker:innen nach wie vor bekannt.
Um eine solche Hürde für offenes Arbeiten aufzubauen, bedarf es nicht unbedingt einer ablehnenden Haltung in der Leitung. Es genügt schon, dass ein:e Justiziar:in im Rahmen der Routineprüfung einer Vereinbarung mit einem Dienstleister über den Begriff der offenen Lizenzierung von Ergebnissen stolpert und aus Unsicherheit oder Unkenntnis heraus fordert, der Dienstleistungsvertrag müsse hier umgeschrieben werden und klarstellen, dass die Nutzungsrechte der Leistung ausschließlich an die Auftraggeberin übertragen werden.
Warum wir das hier anbringen? Es kostet nichts, keinen einzigen Euro, dies zu ändern. Rechtssicherheit für die handelnden Personen ist oft schon gegeben. Wo sie nicht gegeben ist, lassen sich Gesetze und Verordnungen schreiben, die klar „public money, public code, public content“ vorgeben. Wo die Rechtssicherheit bereits gegeben ist, da schadet es überhaupt nicht, eine ergänzende Open Policy in der eigenen Institution umzusetzen. Rechtssicherheit entsteht auch durch die klare Kommunikation des geltenden Rechts und der eigenen Strategie. Wenn Ihre eigene Einrichtung hier noch Nachholbedarf hat, lässt sich das verhältnismäßig leicht ändern.
Verbindliche Nutzung von Standards und standardisierte Schnittstellen
Standards ermöglichen in der wissenschaftlichen Praxis wie auch im Kontext von OER Auffindbarkeit, Nachvollziehbarkeit und Nachnutzbarkeit von Inhalten und Daten. Im Kontext von Software ermöglichen Standards die Migration von Inhalten und Prozessen sowie den Austausch über verschiedene Systeme hinweg. Standards zu Schnittstellen, Datei- und Datenformaten wirken einem Vendor Lock-in entgegen und ermöglichen es Betreibenden, die Software, die einen bestimmten Service ermöglicht, zu wechseln. Damit unterstützt diese Forderung abhängig von ihrem Kontext jede der obenstehenden drei Perspektiven. Standards ermöglichen Open Science und Open Education. Standards machen Hochschulen strategiefähig im digitalen Raum. Und Standards ermöglichen die Verknüpfung von proprietären und offenen Systemen gleichermaßen, ebenso wie einen Wechsel von Software A zu Software B.
Bereitstellung öffentlicher Infrastruktur & verlässliche Finanzierungsrahmen für Open-Source-Entwicklung
Die Förderung von Infrastruktur ist so alt wie die Idee eines öffentlichen Wissenschafts- und Bildungssystems selbst. So wie sich Forschende und Lernende in Gebäuden aufhalten können müssen, wenn sie ihrer Arbeit nachgehen, so sollen sie sich auch in digitalen Räumen, in Software, frei bewegen können.
Das hat mehrere Voraussetzungen und zwei dieser Voraussetzungen sind essenziell:
- Die digitalen Räume, also Software, muss betrieben werden: An Hochschulen braucht es hier kaum Überzeugungskraft. Über den Umstand, dass irgendein Betriebsmodell, sei es in Cloud-Architekturen oder on-premise, mit eingekauftem Support oder mit einem eigenen User Desk, notwendig ist, herrscht Einigkeit. Selbst wenn eine Hochschule den Betrieb einer Software auslagert, so ist man sich doch einig: Irgendwo betreibt jemand einen Service, der von Hochschulangehörigen genutzt wird – selbst dann, wenn die Nutzung des Service niemandem außer der Nutzerin bekannt ist.
- Die Software, die betrieben wird, muss auch entwickelt werden. Hier haben wir es mit einem Dilemma zu tun. Zwar sind Hochschulen gern bereit, bereits entwickelte Software zu nutzen. Diese Software in ihrer Entwicklung zu unterstützen, ist jedoch nicht so weit verbreitet. Während es bei proprietärer Software üblich ist, Lizenzen zu zahlen, so gehen Hochschulen bei OSS noch zu oft davon aus, dass sie einfach entstanden zu sein scheint, bereits da ist und deswegen die Entwicklung auch keine weitere Aufmerksamkeit benötige. Und während es zwar richtig ist, dass OSS frei zu nutzen ist, so ist es doch auch richtig, dass OSS ebenso wie jede andere Software auch eine konstante Weiterentwicklung und Pflege benötigt, um sicher, verlässlich und verfügbar zu sein.
Die Teilnehmenden im Workshop waren sich einig, dass beide hier genannten Aspekte noch Arbeit und Zuwendung brauchen. In Teilen ist das, was hier kurz beschrieben wird, von Hochschulen leistbar. Der Betrieb von Software wird an Hochschulen selbst organisiert oder vergeben. Insbesondere in der Software-Entwicklung sind die Aufgaben jedoch so groß, dass sie von einzelnen Hochschulen nur schwer zu überschauen oder abzuarbeiten sind.
Ein Beispiel aus der Praxis: Im niedersächsischen Projekt Open Source Development Network (OSDN) arbeiten daher mehrere Hochschulen zusammen, um die für die Hochschullehre kritische Software kooperativ weiterzuentwickeln. Das Projekt wird mit Mitteln der Hochschule.digital Niedersachsen im Verbundprojekt Digitale Lehre Hub Niedersachsen gefördert. Es sieht vor, dass Hochschulen gemeinsam mit den Entwickelnden der Software-Produkte Bedarfe und Roadmaps abstimmen und die daraus resultierenden Weiterentwicklungen der Software beauftragen. So werden Parallelentwicklungen vermieden, die Software kann im Kern weiterentwickelt werden und somit profitieren alle davon, die mit einem neuen Release oder Update die Resultate erleben.
Fazit: Open Source ermöglicht Open Science und Open Education
In seinem Impulsbeitrag bei der KNOER-Tagung hat Michael Jäckel ein altes, aber nach wie vor gültiges Zitat von Jon Tennant hervorgeholt: „Open Science is just Science done right.“ Wie immer bei pointierten Aussagen: auch an diesem Ausspruch gibt es vereinzelt Kritik, die auch ernstzunehmen ist. Es gibt mit Sicherheit Umstände, unter denen die Prinzipien von Open Science und Open Education mithilfe von proprietärer Software besser verfolgt werden können. Einstiegshürden können niedriger sein, die Installationsbasis über alle Nutzenden hinweg kann größer sein.
So weit wir das verfolgen konnten, war es jedoch für kein:e Teilnehmer:in vorstellbar, Open Science und Open Education ohne OSS verfolgen zu können. Das zeigen die Forderungen aus dem Workshop klar. Die Förderung eines offenen Ökosystems von Software bleibt also die Aufgabe von Einzelpersonen und ihren Institutionen, aber auch klarer Auftrag an Ministerien in Bund und Ländern, in denen Rahmenbedingungen und Handlungsspielräume festgelegt werden. Im Kontext der Verwaltungssoftware gibt es hier mit dem Land Schleswig-Holstein einen Vorreiter. Mit der Sovereign Tech Agency und dem Zendis gibt es auf Bundesebene eine klare Positionierung, die jedoch gemessen an den Ausgaben für Software-Lizenzen noch stärker hinterlegt sein könnte. Was fehlt: die Sovereign Tech Agency für Bildung und Wissenschaft.
Steffen Rörtgen arbeitet am FWU und befasst sich dort mit der maschinenlesbaren Abbildung von Lehrplänen im Schulbereich. Außerdem interessiert er sich besonders für das Semantic Web und offene Webtechnologien, um mit deren Hilfe Herausforderungen in öffentlichen Bildungsinfrastrukturen zu lösen.
Christian Friedrich ist als Freiberufler Sprecher und Strategischer Berater des Projekts Open Source Development Network.

 © ORCA.nrw
© ORCA.nrw © Canva
© Canva
 © RUB, Marquard
© RUB, Marquard © RUB, Marquard
© RUB, Marquard ORCA.nrw
ORCA.nrw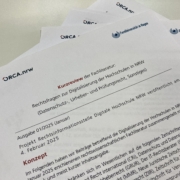 © ORCA.nrw
© ORCA.nrw © ORCA.nrw
© ORCA.nrw
 © Patrick Kaut
© Patrick Kaut © RUB, Marquard
© RUB, Marquard