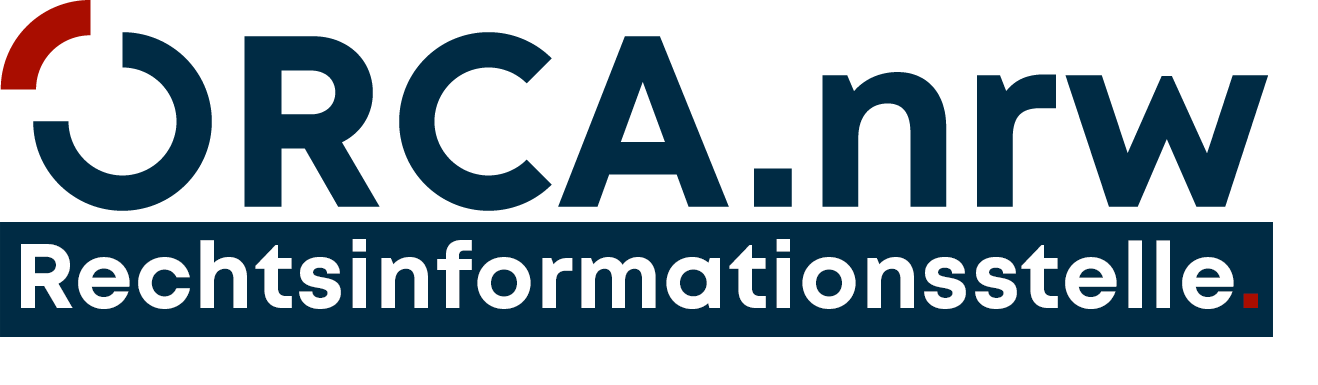Tipp des Monats JULI ’25: Online-Brückenkurs Physik
ORCA.nrw bietet spezielle Unterstützungsangebote für den Übergang von der Schule zur Hochschule an. Unter dem Motto „Starker Start ins Studium“ finden sich kostenlose Online-Tests und Selbstlernkurse zu den Bereichen Mathematik, Sprach- und Textverständnis sowie Motivation und Lernstrategien. Ganz neu gesellt sich auch der Online-Brückenkurs Physik dazu – unser OER-Tipp des Monats Juli.
MATERIAL
Was misst man in Joule? Wie bestimmt man die kinetische Energie eines fahrenden Autos? Warum erscheint der Himmel tagsüber blau? Die Antwort auf diese Fragen erhält man im Online-Brückenkurs Physik. Der digitale Selbstlernkurs unterteilt sich in sechs Kapitel, die unabhängig voneinander durchlaufen werden können. Nach dem Einführungskapitel mit Bearbeitungshinweisen folgen die fachlichen Kapitel zu physikalischen Grundlagen, Mechanik, Elektromagnetismus, Optik und Wärmelehre.
ZIELSETZUNG
Der Kurs richtet sich an Studieninteressierte sowie Studienbeginnerinnen und -beginner der Ingenieurwissenschaften. Auch für Studierende mit Physik als Nebenfach kann der Physik-Brückenkurs interessant sein. Ziel ist es dabei, jeder und jedem eine individuelle Vorbereitung auf den Physikanteil im Studium zu ermöglichen.
ENTSTEHUNGSGESCHICHTE
Der Ursprung des Brückenkurses stammt aus Nordrhein-Westfalen. An der RWTH Aachen, an der traditionell zahlreiche Studiengänge Physik beinhalten, wurde zunächst ein Kurs entwickelt, um die in der Schule erworbenen Kenntnisse im Bereich Physik zu wiederholen oder zu vertiefen. 2017 wurde dann das Projekt Online-Brückenkurs Physik ins Leben gerufen und unter anderem durchs Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst des Landes Baden-Württemberg gefördert, der Kurs der RWTH diente dabei als Grundlage. Seit Frühjahr 2025 ist der weiterentwickelte Kurs auch über ORCA.nrw kostenfrei abrufbar.
ERSTELLERINNEN UND ERSTELLER
Der Online-Brückenkurs Physik ist ein gemeinsames Projekt des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) und der Universität Stuttgart mit den Universitäten RWTH Aachen, TU Berlin, Ruhr-Universität Bochum, Technische Universität Dresden und den Hochschulen FH Aachen, TH Mittelhessen, HAW Reutlingen, TH Rosenheim sowie den Trägern des Projektes MINTFIT Hamburg, Universität Hamburg, Hochschule für Angewandte Wissenschaften (HAW) Hamburg, Technische Universität Hamburg und HafenCity Universität Hamburg unter Federführung des MINT-Kollegs. Der Brückenkurs wird von TU9, der Allianz neun führender technischer Universitäten in Deutschland empfohlen.
PERSÖNLICHE NUTZUNGSEMPFEHLUNG

PD Dr. Edme Hardy (MINT-Kolleg BW am KIT): „Ich empfehle den Online-Brückenkurs Physik allen, die sich fundiert auf ein ingenieur- oder naturwissenschaftliches Studium vorbereiten möchten. Der Kurs hilft nicht nur dabei, zentrale Inhalte aus der Mittel- und Oberstufe zu wiederholen, sondern bietet mit interaktiven Übungen, anschaulichen Videos und Tests zur Selbsteinschätzung eine durchdachte Lernumgebung. Besonders hervorzuheben ist, dass der Kurs im Rahmen einer bundesweiten Kooperation entwickelt wurde – mit dem klaren Ziel, den Übergang von der Schule zur Hochschule nachhaltig zu verbessern – und sogar von der TU9, dem Zusammenschluss führender technischer Universitäten in Deutschland, ausdrücklich empfohlen wird. Und das Beste: Er ist kostenlos und jederzeit online verfügbar.“